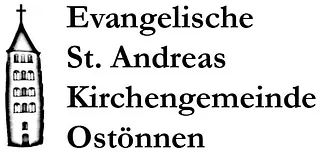Heiliger Bimbam!
Kirchenglocken: Sie laden zum Gottesdienst ein, erklingen sowohl bei Taufen als auch bei Todesfällen, verkünden die Uhrzeit und begleiten mit ihrem Klang das "Vater unser".
Im Turm der St. Andreas-Kirche in Ostönnen hängt eine der ältesten Glocken der Soester Börde. Sie wurde vermutlich am Tag der Geburt Johannes des Täufers (24. Juni) im Jahr 1306 gegossen. Wo und von wem die Bronzeglocke gegossen wurde, ist leider nicht bekannt. Die wertvolle Kirchenglocke trägt die Umschrift: RECTOR COELI NOS EXAUDI - TU DIGNARE NOS SALVARE (Herrscher des Himmels erhöre uns - Du bist würdig uns zu erlösen).
Die beiden anderen Glocken im Turm der evangelischen Kirche St. Andreas sind ein einfacher Ersatz für die Glocken, die im ersten Weltkrieg abgegeben werden mussten. Diese wurden eingeschmolzen und verkündeten statt des Gotteslobes die Stimme von Krieg und Gewalt. Nach dem Krieg wurden zwei eiserne Glocken in Auftrag gegeben, um das Geläut im Glockenstuhl wieder aufzufüllen. Diese wurden 1919 von der Firma Schilling & Lattermann in Morgenröthe-Rautenkranz im Vogtland (Sachsen) gegossen, anschließend im thüringischen Apolda mit Armaturen für die Aufhängung versehen. Sie tragen Psalmverse. Die Hartgussglocken sind allerdings qualitativ schlecht, sind porös und weisen Luftblasen auf.
Eine vierte Glocke hängt an der Südseite des Turmhelms. Es ist die spätgotische Uhrglocke aus dem Jahr 1513, welche die Namen "Maria" und "Anna" (die Mutter Mariens) trägt. Sie gibt zuverlässig an, was die Stunde geschlagen hat.
Das Schweigen der Glocken
Aus klingenden Boten wurden todbringende Geschosse: Im Ersten Weltkrieg, der von 1914 bis 1918 wütete, verloren rund 17 Millionen Menschen ihr Leben. Viele wurden vom einst geweihten Metall der Kirchenglocken getroffen, die massenhaft zu Munition umgegossen wurden.
Die deutsche Rüstungsindustrie verschlang im Ersten Weltkrieg geradezu unersättlich Metalle. Durch die Entwicklung neuer Geschütze, Pistolen und Gewehre, wie dem Maschinengewehr 08/15, benötigte das Militär viel mehr Munition als in früheren Kriegen. Die Rohstoffe für diese Materialschlachten kamen zum Teil von den deutschen Bürgern: Am Anfang des Krieges gaben sie im patriotischen Kriegstaumel Zinnkrüge und Messingpfannen für die Waffenschmieden ab.
Doch das reichte schon bald nicht mehr aus. Das Kriegsministerium stieß auf größere, noch unerschlossene Metallvorkommen: auf Kirchenglocken. Am 1. März 1917 ordnete es an, dass alle Bronzeglocken im Deutschen Reich registriert werden müssen, damit man einen Überblick über deren Bestand bekommt. Alle Besitzer von Bronzeglocken wurden enteignet - widersetzten sie sich, drohten ihnen Strafen. Einzig Glocken, die den Eisenbahn-, Schiffahrts- und Straßenbahn-Verkehr regelten sowie die Glocken der Feuerwehr waren von dieser Anordnung ausgenommen.
Anhand der von den Kirchengemeinden erstellten Listen wurden die Bronzeglocken von Sachverständigen in eine von drei Kategorien eingeordnet. Glocken der Gruppe A mussten grundsätzlich so schnell wie möglich abgeliefert und eingeschmolzen werden. Die Bronze-Glocken dieser Kategorie waren meist nach der Mitte des 19. Jahrhunderts gegossen worden. Die Glocken der Gruppe B mit mäßigem kulturellen und historischen Wert wurden zunächst zurückgestellt. Glocken, die man der Gruppe C zuordnete, wurden generell geschützt und durften im Glockenturm hängen bleiben. Außerdem sollte jede Kirche mindestens die kleinste ihrer Glocken behalten dürfen. Rund die Hälfte aller Kirchenglocken wurden im Zuge dieser Aktion ab Frühjahr 1917 eingeschmolzen.
Die Gemeinden wurden für den Verlust ihres Geläuts finanziell "entschädigt". 3,50 Mark pro Kilogramm Metall war dem Staat eine Glocke wert, die weniger als 650 Kilogramm auf die Waage brachte. Bei den schwereren Exemplaren sankt der Kilo-Preis auf zwei Mark. Zudem gab es eine Grundentschädigung von 1000 Mark. Das Geld sollte nach dem Krieg dem Kauf neuer Glocken dienen. Doch nach dem Kriegsende blieb wegen der Inflation davon nichts übrig.
Dennoch entstand eine Art Glocken-Industrie - schließlich waren die Lücken in den Glockentürmen groß und der Bedarf an Ersatzglocken riesig. Die beiden stählernen Glocken für Ostönnen stammen aus dieser Zeit der Massenproduktion: Um die Lücken im Glockenbestand der Nachkriegszeit wieder zu füllen, gründeten der Glockengießermeister Otto Schilling und der Hammerwerksbesitzer Gottfried Lattermann in Morgenröthe-Rautenkranz im Vogtland 1918 unter der Firmenbezeichnung Schilling & Lattermann eine OHG "zum Zwecke des Gusses und Vertriebs von Hartgussglocken". Der Sitz war Apolda, die Dauer der Zusammenarbeit zunächst bis 1927 festgelegt. Die Führung der Geschäfte stand nur dem Gesellschafter Schilling zu, der den gesamten Vertrieb der Glocken übernahm. Lattermanns Aufgabe war es, sämtliche in Auftrag gegebene Glocken in seinem Morgenröther Werk nach den Angaben und Entwürfen von Schilling gießen zu lassen. Die dort gegossenen Glocken wurden nach Apolda gebracht und in der Schmiede und Schlosserei mit Armaturen und Glockenstühlen versehen.
Der Niederländer Dennis Wubs, Organist und Orgelsachverständiger, nahm das Geläut der Ostönner Kirchenglocken auf Video auf.
Warum es morgens um 6 Uhr sieben Mal läutet
„... da lebe ich doch schon bald 70 Jahre in Ostönnen, aber das habe ich nicht gewusst!“ Mein Gesprächspartner hatte mich gefragt, was es eigentlich mit dem komischen Schlagen der Glocke morgens um 6.00 Uhr auf sich habe. Da sei doch alles ganz durcheinander. Statt sechs Schlägen würde er immer sieben Schläge zählen - und die kämen dann auch noch dreimal hintereinander. Bald 70 Jahre lebe er jetzt in Ostönnen, habe das irgendwie immer schon gehört, aber jetzt wolle er einmal wissen, was das eigentlich bedeutet.
Also lieber Pastor, gib Rede und Antwort: Das Schlagen am Morgen um 6.00 Uhr und auch um 12.00 Uhr mittags ist das sogenannte Gebetsläuten. Die Gebetsglocke wird siebenmal hintereinander angeschlagen und das Ganze dreimal. Warum? Die sieben Schläge stehen für die einzelnen Bitten des Vaterunsers, jede Bitte bekommt einen Schlag.
Vater unser im Himmel,
- geheiligt werde dein Name.
- Dein Reich komme.
- Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
- Unser tägliches Brot gib uns heute.
- Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
- Und führe uns nicht in Versuchung,
- sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Da wir Christen an Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist glauben und ja auch ein Gottesdienst immer „Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ beginnt, wird das Vaterunser auch dreimal wiederholt, also drei mal sieben.
Aha?! Und warum das Ganze dann so früh am Morgen, am Mittag und was ist am Abend? Das Gebetsläuten soll uns daran erinnern, wer uns den neuen Tag schenkt, wer unser Leben erhält, wer uns Orientierung gibt und welche Gebote uns durch den Tag leiten sollen. Mit Gott beginne ich meinen Tag, halte in der Mitte des Tages einen Moment inne und beschließe den Tag um 18.00 Uhr mit Gott. Für mich ist das eine ganz wichtige Erinnerung daran, dass dieser Tag nicht den Mächten dieser Welt gehört, nicht dem Staat oder den Politikern, nicht den Kriegstreibern dieser Welt, nicht dem Geld mit seiner Macht, aber auch nicht den Sorgen und Ängsten, die sich bestimmt wieder melden werden. Jeder Tag gehört Gott: Mit ihm beginne ich, er führt mich zum Mittag und mit ihm beschließe ich den Tag.
Allerdings: In Ostönnen haben wir vor etwa 20 Jahren das Gebetsschlagen um 18.00 Uhr geändert. Es läutet dann für drei Minuten die Friedensglocke. Der Tag neigt sich zum Abend und wir bitten um Frieden für uns und diese friedlose Welt. Man kann dieses Läuten um 18.00 Uhr jedoch auch noch anders verstehen: Jemand sagte mir einmal: „Wenn ich abends die Glocke höre, dann denke ich, jetzt hat auch der Pastor Feierabend...!“
Pastor Volker Kluft